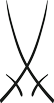Kirchenorgel mit Pfeifen
aus Meissener Porzellan
-
 Am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2025, wurde ein bedeutendes Kapitel Musik- und Porzellangeschichte aufgeschlagen: Die Jehmlich-Orgel in der Frauenkirche Meißen wurde feierlich als weltweit erste Kirchenorgel mit klingenden Orgelpfeifen aus Meissener Porzellan eingeweiht. Mit insgesamt 37 Pfeifen aus dem „Weißen Gold“ wurde das historische Instrument auf einzigartige Weise erweitert – eine Symbiose aus traditionellem Orgelbau und meisterhaftem Kunsthandwerk, die in dieser Form weltweit einmalig ist.
Am Pfingstsonntag, dem 8. Juni 2025, wurde ein bedeutendes Kapitel Musik- und Porzellangeschichte aufgeschlagen: Die Jehmlich-Orgel in der Frauenkirche Meißen wurde feierlich als weltweit erste Kirchenorgel mit klingenden Orgelpfeifen aus Meissener Porzellan eingeweiht. Mit insgesamt 37 Pfeifen aus dem „Weißen Gold“ wurde das historische Instrument auf einzigartige Weise erweitert – eine Symbiose aus traditionellem Orgelbau und meisterhaftem Kunsthandwerk, die in dieser Form weltweit einmalig ist.
Eine Idee mit langer Geschichte - Die Vision, Orgelpfeifen aus Porzellan herzustellen, reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Bereits Johann Joachim Kaendler – einer der bedeutendsten Künstler der Frühzeit der Manufaktur – versuchte sich gemeinsam mit dem Orgelbauer Johann Ernst Hähnel an diesem gewagten Vorhaben. Zwischen 1732 und 1737 entstanden erste Entwürfe und Prototypen – doch das empfindliche Material stellte die beiden immer wieder vor unlösbare Herausforderungen.
Die Vision einer Porzellanorgel blieb zunächst unerfüllt. Auch in den folgenden Jahrhunderten gab es immer wieder Versuche, Porzellan zum Klingen zu bringen: von der Ocarinafabrik Freyer & Co. im 19. Jahrhundert über experimentelle Instrumente von Emil Paul Börner in den 1920er Jahren bis hin zu einem bemerkenswerten Fund in den 1950er Jahren, als der MEISSEN Gestalter Ludwig Zepner alte Entwürfe wiederentdeckte. 2000 gelang es Zepner schließlich, gemeinsam mit der Firma Jehmlich Orgelbau Dresden, erstmals klingende Orgelpfeifen aus Meissener Porzellan herzustellen.
Was einst nur ein mutiger Traum war, ist nun zur Realität geworden: Die Jehmlich-Orgel in der Meißner Frauenkirche wurde eigens für die Aufnahme von Porzellanpfeifen konzipiert und nun mit 12 Bass- und 9 Diskantpfeifen sowie einem vollständigen Register von c0 bis c3 aus Meissener Porzellan ergänzt. Die historische Orgel, selbst ein Zeitzeuge der deutschen Orgelbewegung und Trägerin des ältesten erhaltenen Pfeifenmaterials Sachsens, wurde damit um ein ebenso klangliches wie optisches Meisterwerk erweitert.