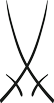Kristallglasurvasen – Anmut des Zufalls
-
 Mit einer Serie von Kristallglasurvasen des Künstlers Horst Gottschaldt widmet sich MEISSEN einer exquisiten Kunstform, deren Ursprung vor über tausend Jahren in Japan und Korea liegt. In ihr zeigt sich eine Ästhetik des Zufalls, deren Reiz in der Reflexion des Lichts, der suggestiven Erscheinung und spektralen Tiefe liegt. Aufgrund des überaus sensiblen Herstellungsprozesses gilt die Kristallglasur-Technik bis heute als das Schwierigste und Reizvollste, was die keramische Handwerkskunst hervorbringt: zauberhafte große und dreidimensional wirkende Kristalle. Die Ursache der Kristallbildung ist eine stark zinkoxidhaltige Glasur, in Verbindung mit auf verschiedene Farbnuancen abgestimmte Brennprozesse. Diverse mineralogische Farbcarbonate bringen ein breites Spektrum an Kristallfarben von dunklen, mediterranen Tönen, Blau, Grün bis zu reinem Weiß zur Wirkung. Das Ergebnis der Glasuren lässt sich dabei nur bedingt steuern, das Kristallwachstum geschieht während des Abkühlungsprozess und machen jede Vase zu einem naturgewachsenen Unikat.
Mit einer Serie von Kristallglasurvasen des Künstlers Horst Gottschaldt widmet sich MEISSEN einer exquisiten Kunstform, deren Ursprung vor über tausend Jahren in Japan und Korea liegt. In ihr zeigt sich eine Ästhetik des Zufalls, deren Reiz in der Reflexion des Lichts, der suggestiven Erscheinung und spektralen Tiefe liegt. Aufgrund des überaus sensiblen Herstellungsprozesses gilt die Kristallglasur-Technik bis heute als das Schwierigste und Reizvollste, was die keramische Handwerkskunst hervorbringt: zauberhafte große und dreidimensional wirkende Kristalle. Die Ursache der Kristallbildung ist eine stark zinkoxidhaltige Glasur, in Verbindung mit auf verschiedene Farbnuancen abgestimmte Brennprozesse. Diverse mineralogische Farbcarbonate bringen ein breites Spektrum an Kristallfarben von dunklen, mediterranen Tönen, Blau, Grün bis zu reinem Weiß zur Wirkung. Das Ergebnis der Glasuren lässt sich dabei nur bedingt steuern, das Kristallwachstum geschieht während des Abkühlungsprozess und machen jede Vase zu einem naturgewachsenen Unikat.
"Es ist eine Ästhetik des Zufalls, deren Reiz in der Reflexion des Lichts, der suggestiven Erscheinung und spektralen Tiefe liegt."
-
 Obgleich die Geschichte der Kristallglasur über tausend Jahre zurückreicht, erfuhr sie – als Folge der erstmaligen Präsentation auf der Pariser Weltausstellung 1900 – im Jugendstil ihre erste Blütezeit in Europa. Hieran trugen neben MEISSEN – durch unter anderem den Maler Paul Börner – vor allem die Manufakturen Sèvres in Frankreich und Kopenhagen bei. Aufgrund der Komplexität und Instabilität des Herstellungsprozesses und den damit verbundenen hohen Kosten – Stücke wurden im Preis mit Gold aufgewogen – wurde die Produktion allerdings schon bald wieder eingestellt. Erst durch technische Innovationen gegen Ende des 20. Jahrhunderts popularisierte sich die Technik erneut und erfuhr durch Künstler wie Ludwig Zepner in Zusammenarbeit mit Christoph Ciesielski in den 1990‘er Jahren eine künstlerische Renaissance. Dabei entstanden unikale Gefäße wie Vasen und Schalen sowie Bildplatten. Frank Michaelis widmete sich dann später auf Grundlage eigener Techniken den Kristallen auf Porzellanplatten.
Obgleich die Geschichte der Kristallglasur über tausend Jahre zurückreicht, erfuhr sie – als Folge der erstmaligen Präsentation auf der Pariser Weltausstellung 1900 – im Jugendstil ihre erste Blütezeit in Europa. Hieran trugen neben MEISSEN – durch unter anderem den Maler Paul Börner – vor allem die Manufakturen Sèvres in Frankreich und Kopenhagen bei. Aufgrund der Komplexität und Instabilität des Herstellungsprozesses und den damit verbundenen hohen Kosten – Stücke wurden im Preis mit Gold aufgewogen – wurde die Produktion allerdings schon bald wieder eingestellt. Erst durch technische Innovationen gegen Ende des 20. Jahrhunderts popularisierte sich die Technik erneut und erfuhr durch Künstler wie Ludwig Zepner in Zusammenarbeit mit Christoph Ciesielski in den 1990‘er Jahren eine künstlerische Renaissance. Dabei entstanden unikale Gefäße wie Vasen und Schalen sowie Bildplatten. Frank Michaelis widmete sich dann später auf Grundlage eigener Techniken den Kristallen auf Porzellanplatten.
Ihre erste europäische Blütezeit hatte die Kristallglasur im Jugendstil nach ihrer erstmaligen Präsentation auf der Pariser Weltausstellung 1900 – Objekte wurden damals mit Gold aufgewogen. Das Wiederaufleben von Kristallglasuren ist in großem Teil der Entwicklung der Ofenregeltechnik sowie dem Zugang zu verwendeten Mineralien zu verdanken. Für lange Zeit waren die chemischen Prozesse, welche die kristallinen Strukturen hervorbrachten, noch unbekannt, die Rohstoffe für deren Verwendung darüber hinaus nur in schwankender Qualität verfügbar. Gute Ergebnisse waren entsprechend selten und äußerst wertvoll.
Der Ursprung der Kristallbildung liegt in einer stark zinkoxidhaltigen Glasur, die während des Abkühlprozesses das Kristallwachstum ermöglicht. Titan-, Eisen-, Kobalt-, Nickel- oder Kupferoxid werden zusätzlich beigemischt, um das Spektrum unterschiedlicher Farben hervorzubringen und verstärken teilweise sogar das Kristallwachstum. Aufgrund der zahlreichen Variablen bleiben die Resultate des Prozesses bis heute weitgehend zufällig und jedes Stück damit ein Unikat.